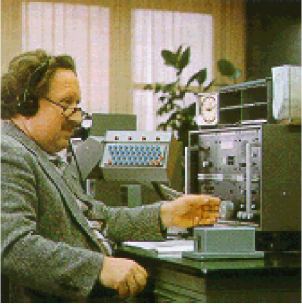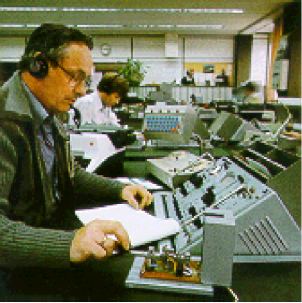| Ein bißchen Technik, ein
bißchen Geschichte
In den 30er Jahren wurde "Scheveningen Radio"
international zu einer Küstenfunkstelle ersten Ranges. Auf Mittel-, Lang- und Kurzwelle
arbeiteten viele Sender. Vor allem die Kurzwelle war im Kommen hatte aber noch einige
Hindernisse zu überwinden, vor allem in bezug auf die Geräte mit den Kollektorfunken.
Die Antennen für den Empfang der häufig schwachen Signale, die zuweilen doch über
hunderte von Kilometern durch den Äther kamen, standen praktisch auf bebautem Gebiet.
Technisch konnte man zu jener Zeit recht wenig dagegen tun, so kam nur ein Umzug in Frage,
aber wohin? 1930 wurden die Kurzwellenempfangs- und Sendeantennen an einem "ruhigen
Platz in den Dünen" wieder aufgebaut. Die Empfänger wurden vom Zentrum von Ijmuiden
aus fernbedient, auch nichts Neues! Nach einigen Jahren sollte eine lokale Bedienung der
Betriebssicherheit zugute kommen, und so wurde eine vollständige Filiale mit drei
Abteilungen eingerichtet. Die Kurzwellenabteilung mit zwei Arbeitsplätzen, den
Landleitungsdienst via Telex mit dem Hauptbüro und der noch recht neuen Funktelefonie mit
einem Arbeitsplatz. Der Funkverkehr auf Kurzwelle war damals noch nicht so weit verbreitet
wie heute. Die Arbeit fing erst gegen Mittag auf dem 24 Meterband an. Abhängig von den
Zeitzonen und den häufig damit verbundenen Ausbreitungsbedingungen wurde auf das 26
Meterband umgeschaltet, wo bessere Sende- und Empfangsmöglichkeiten herrschten. Obwohl
eine Küstenfunkstelle für die Schiffahrt, wurde damals merkwürdigerweise auch mit
Flugzeugen gearbeitet. Es waren vor allem Flugzeuge auf der Indienroute. Später wurde
auch auf dem 18 Meterband gearbeitet, überwiegend in den Morgenstunden. Der Telexverkehr
mit dem Hauptbüro war sehr lebhaft, nachts ging es im Äther eher ruhig zu und es wurde
nur von Ijmuiden aus gearbeitet.
Die Empfänger in den Jahren vor 1926 waren in eigener
Regie gebaut worden und bestanden aus Spulen mit Gleitkontakten, großen platten
Abstimmkondensatoren und, damals noch, einer Röhre mit drei Elektroden als
Detektor-Verstärker. Abgestimmt wurde nach Gehör, denn von einer Abstimmskala war noch
keine Rede. In Ijmuiden wurde gründlich modernisiert, d.h. es wurden
Hochfrequenzverstärker in Betrieb genommen, die die Empfangsqualität und -stärke
wesentlich verbesserten. Eingeweihte wußten es zu schätzen, daß die Neutrodyneschaltung
von Koopmans wieder verwendet wurde.
Das damalige PTT-Funklaboratorium (Vorgänger des Dr.
Neher-Laboratorium) sorgte danach noch für einen "Geradeausempfänger" und von
Telefunken kam für die Arbeitsfrequenz ein spezieller Schiffsempfänger, beide Teile
verrichteten viele Jahre einen hervorragenden Dienst auf Mittelwelle. Die Langwelle bekam
auch einen Telefunkenempfänger, eine Erbschaft aus der Funkverbindung mit Indien, wo die
PTT eine so große Rolle gespielt hatte. Das riesige Gerät war mit verstellbaren Spulen
und großen Abstimmrädern ausgerüstet. Die Kurzwellenempfänger, Geradeausempfänger mit
zwei Abstimmknöpfen, kamen ebenfalls aus dem Funklaboratorium. Das "Häuschen in den
Dünen" bekam später Fabrikempfänger von HRO: Betriebssicher und zuverlässig. Bis
Mai 1940 funktionierte auch alles.
Am 29. Juni 1945 feierte "Scheveningen Radio" von
Den Haag aus seine triumphale Rückkehr in den Äther. Zwei alte Mittelwellensender wurden
aus dem Zentralmagazin der PTT geholt und von einer Antenne, die an einem Antennenmast und
einem Gaslichthalter festgemacht wurde, erklang wieder das CQ von PCH. Der Schlepper
"Hudson" hieß Scheveningen in der "Freien Luft" herzlich willkommen,
und manche Kollegen anderer Küstenfunkstationen schickten von sich aus Nahrungspakete.
Die 600 Meter Not- und Anruffrequenz war wieder bemannt, eiligst auch in Ijmuiden. Von
einem Schiff aus, das länger in Reparatur war, wurde ein Kurzwellendienst unterhalten
unter dem Rufzeichen PCH/2. Dieser Trick wurde auch später noch einige Male angewandt.
In Scheveningen war es ein ständiges Kommen und Gehen der
PTT-ler, die nach und nach eingestellt wurden. Die Küstenfunkstelle kam schnell wieder
auf die Beine und konnte somit im Äther helfen. Es wurden Schiffssender von "Radio
Holland" angemietet, das auch viele Jahre lang das Personal zur Verfügung stellte.
Einige Damen der Verwaltung hatten soviel Interesse an dem operativen Dienst, daß sie zu
bestimmten Zeiten, später definitiv, das Büropersonal zur Nutzung von Kopftelefonen
überreden konnten. Dies führte nach einer gewissen Zeit zu einer ungeahnten Ablösung
des Personals bei der Radiotelefonie: Diese wurde größtenteils von den Frauen in Besitz
genommen....
Mancher Schiffer und Fischer hörte auf dem 123 Meter-Band
zu seinem Vergnügen die Telefonistinnen rufen.
In der Notunterkunft in Ijmuiden, einer Schule in der
Houtmannstraat, wuchs die Anzahl der Arbeitsplätze ständig. Manchmal mußten die
Telegrafisten ihre Arbeit im Stehen verrichten, da sämtliche Stühle besetzt waren. Es
liegt an der menschlichen Anatomie, sich auszubreiten. In der dichtgedrängten Kantine,
übrigens ein Gang von 1 x 5 Metern, standen die maschinellen Stanzmaschinen (die
"Creeds") und ein Kastenberg diente als "Arbeitsplatz und Magazin".
Die Stimmung litt kaum darunter, aber alle waren sich einig, daß dies ein unhaltbarer
Zustand war. Es sollte bis 1951 so gehen, bevor umgezogen werden konnte.
Aber was für ein großzügiges Gebäude gab es am 2.
Sluiseiland! Räume für die Funktelefonie, und noch mehr Platz für die Funktelegrafie,
extra Büros für die Landleitungen (Telegrafie und Übermittlung), einen technischen
Dienst (TD), einen eigenen Kursusraum. Es war nicht zu übersehen, "Scheveningen
Radio" hatte wieder ein eigenes Haus.
Neue Sender wurden in Kootwijk aufgestellt. Bei der
Bestellung wurde Wert darauf gelegt, daß sie für den Funkverkehr geeignet sein mußten.
Das heißt, für die Telegrafie und die Telefonie, und dies nicht nur für eine bestimmte
Frequenz sondern pro Sender auch für eine Anzahl verschiedener Kanäle. Der erste Sender
ging mit einer nominalen Ausgangsleistung von 10 kW auf 22,5 MHz als PCH98 im Mai 1951 auf
Sendung, dieses noch vor der Eröffnung des neuen Gebäudes. Im November 1953 standen
schon sechs Sender, die für den "Festen Funkverkehr" bestimmt waren, dem
Funkverkehr zwischen festen Stationen. Später kamen noch stärkere Sender hinzu, die 30
kW Ausgangsleistung hatten, für die Funktelefonie dazu. Die meisten Sender strahlten ihre
Energie über speziell entwickelte "ground plane"-Antennen aus, die sich in der
Praxis hervorragend bewährten. Alleine für die hohen Frequenzen wurden vertikal- und
horizontal polarisierte Richtantennen benutzt.
Der Grund für die jüngste Verbesserung war der
gewünschte Richteffekt, der vor allem für die hohen Frequenzbereiche bedeutend war. Für
die Bänder 4 MHz, 6 MHz und 22 MHz stand je ein Sender zur Verfügung. Im 8 MHz-Band, 12
MHz- und 17 MHz-Band konnte mit drei Sendern pro Band gleichzeitig gearbeitet werden.
Die Funktelefonie bekam am 2. Sluiseiland acht
Arbeitsplätze sowohl für den Funkverkehr als auch für die Direktverbindung zu den
Abonnenten an Land. Die Funkanlage bestand aus einem RCA AR-88 Empfänger mit einem
Bedienungsfeld, Antennenwahlschalter für Sender und Empfänger, Lautstärkeregler etc.
Auf Petten, Hoek van Holland und Terschelling wurden
Relais-Empfangsstationen installiert. Ein Platz war für die Bedienung der internationalen
Not- und Anruffrequenz bestimmt, 3 Plätze für die Grenzwellentelefonie, zwei für die
Kurzwelle, zwei weitere standen auf "Standby" für besondere Vorkommnisse bzw.
zur Reserve.
Zahlreiche Telefon-, Telegrafie- und Telexleitungen sorgten
für die Verbindung mit dem Hinterland. Direkte Leitungen gingen zur königlichen
Schiffsagentur Dirkzwager te Maassluis (mit der sehr enge Verbindungen bestanden) und der
"KNMI te De Bilt". Und beinahe selbstverständlich stand ein Dieselaggregat im
Keller, das automatisch die Stromversorgung übernahm, falls die normale Netzspannung
ausfallen sollte.
Das Gebäude von "Scheveningen Radio" am 2.
Sluiseiland sah in den Augen eines Laien, aus der Ferne gesehen, wie ein Schiff aus. Lang,
schlank, wie die Aufbauten eines Passagierschiffes am Horizont. Es war ein
wohlüberlegtes, gut durchdachtes und konstruiertes Gebäude, das für die Dienste der
Seefahrt auf den sieben Weltmeeren gebaut war. Zum Bedarf der Kommunikation, schnell und
zuverlässig, ein nahezu unentbehrliches Bindeglied für den maritimen Funkverkehr. |