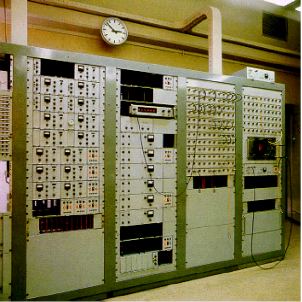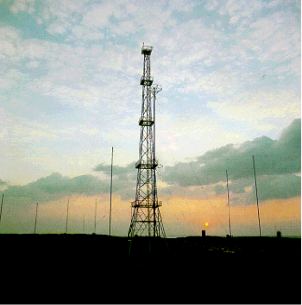| Nach Ijmuiden 1906 werden ungefähr 300 Telegramme über "Scheveningen
Hafen" mit Schiffen auf See ausgetauscht. 1907 wurde die Anzahl der Telegramme schon
verdoppelt. Die Zuwachsrate nahm nach der "Internationalen Funkkonferenz von Berlin,
1906, nach Aufgabe des Marconi-Monopols weiter zu.
Immer mehr holländische Schiffe (z.B. die der
Holland-Amerika-Linie) bekamen die Erlaubnis zum Einbau und Gebrauch von
Funktelegrafie-Anlagen an Bord von Seeschiffen. Nun konnten auch sie mit
"Scheveningen-Hafen" arbeiten. Der Funkverkehr der Küstenfunkstelle nahm immer
weiter zu, vor allem mit Schiffen des Königlich Holländischen Lloyds, der Reederei
Stoomvaart Holland, dem Rotterdamschen Lloyd und auch mit ausländischen Schiffen. 1912
kamen die Schlepper von L. Smit & Co dazu.
Der ursprüngliche Rundfunksender aus der Gründerzeit von
"Scheveningen Radio" wurde recht schnell durch einen Sender ausgetauscht, der
aus dem Haagschen Lichtnetz mit Hilfe eines Drehstromumformers betrieben werden konnte.
Die rotierende Funkenstrecke dieses Giganten sorgte für einen scharfen durchdringenden
Ton, einem "Merkmal" von "SCH" in jenen Tagen.
Der Funkverkehr nahm immer mehr zu und dadurch entstand ein
Bedürfnis nach mehr Sendern. Neben der 600-Meter-Welle als Anruf- und Arbeitsfrequenz kam
die "Langwelle" dazu. Ursprünglich wurde hier mit einem drehenden
Funkbrückensender gearbeitet, später mit einem 5 kW Röhrensender des Fabrikats
Telefunken für die 1800-Meter-Welle. Die Inbetriebnahme dieser Wellenlänge hat eine
weniger schöne Konsequenz, nämlich die gegenseitige Störung von Sendern und Empfängern
der Mittel- und Langwelle. So konnte es passieren, daß der Verkehr auf der
600-Meter-Welle eingestellt werden mußte, wenn der Langwellensender in Betrieb war.
Gegenseitige Störung, was konnte man dagegen tun? Die 600-Meter-Welle unbemannt zu
lassen, war undenkbar. Eine Übergangslösung wurde gefunden indem die Empfänger und die
Bedienung nach Ijmuiden verlegt wurden. 1925 wurde dort eine Hilfsküstenfunkstelle für
die Mittelwelle (600 Meter, später auch 800 Meter) eingerichtet. Die Unterkunft war nun
in einem P- und einem T-Büro.
Schleunigst wurde beschlossen, einen der Sender und
Empfänger auf allen Wellenlängen von Ijmuiden aus zu betreiben. Am 1. Juli 1926 fand der
Umzug nach Ijmuiden statt. Die Sender blieben in Scheveningen und wurden von Ijmuiden aus
per Kabel und Senderelais bedient. Dies betraf die 600-Meter, die inzwischen zur
Arbeitsfrequenz erklärten 705 Meter (ursprünglich 800 Meter) und die Langwelle auf 1800
Meter. Als Sonderdienst auf diesen Wellenlängen wurde die 800-Meter-Welle für Peilzwecke
verwendet. Es wurden drei Peilfunkstellen eingerichtet und zwar bei
Willemsoord/Nieuwediep, Ijmuiden und Maassluis. Später kam noch die Peilfunkstelle
Vlissingen dazu. Mit Hilfe dieser Peilfunkstellen konnten die Positionen von Schiffen
innerhalb von Minuten festgestellt werden. Dies bedeutete für die Seeschiffe, auch bei
Nebel und in stürmischen Nächten sicher gepeilt zu werden. Es ist so auch nicht
verwunderlich, daß PCH eine stets wachsende Zahl von Peilversuchen vornehmen mußte. |
|

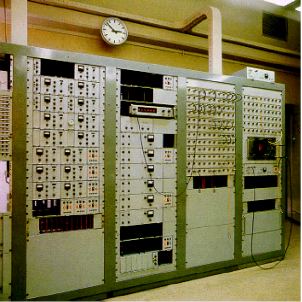
Viele Kilowatt gehen in den Äther!
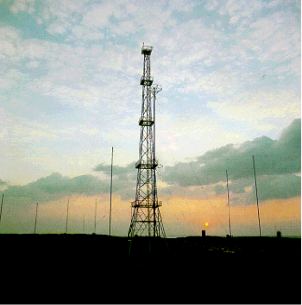
|