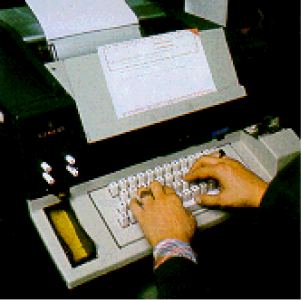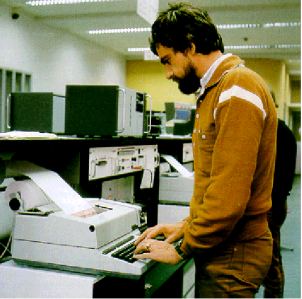| Die Zukunft Bei "Scheveningen Radio" steht ein Computer der die Daten
des gesamten Funkverkehrs mit den Schiffen speichert. Schnell und effizient. In naher
Zukunft wird ein Computer den Prozeß der Verkehrsabwicklung überwachen.
Es gibt Computer, die komplette Telefonzentralen steuern,
die automatisch nachts die Saldi der Girorechnungen schriftlich ausgeben. Ein Computer
gestaltet das Herz des ausgebreiteten Informations- und Kommunikationssystem welches
"Viewdata" genannt wird. Es gibt sehr kleine Computer, Mikroprozessoren, die
besonders schnell und zuverlässig äußerst komplexe Berechnungen machen. Viel schneller
als ein Mensch das kann. Aber der Computer kann eines nicht, ebensowenig wie der Mensch,
in die Zukunft sehen.
Vorhersagen geben, dies ist eine undankbare Beschäftigung.
Wenn die Vorhersage nicht zutrifft, oder auch viel früher oder später eintritt, dann ist
sie bereits verspielt. Jemand hat einmal gesagt: "Ich werde nichts vorhersagen,
sicher nicht über die Zukunft" ...
Die Weiterentwicklung in der Kommunikation geht mit
riesengroßen Schritten voran, so daß der Blick in die Zukunft viele Fragen aufwirft. Es
ist kein "Schauen in eine Kristallkugel des Wahrsagers", vielmehr müssen die
Möglichkeiten und Aspekte der heutigen Entwicklung der Kommunikation als eine geschätzte
Fortsetzung von dem was schon besteht und aus den bekannten Daten gezogen werden. In
diesem Sinne sind die zukünftigen Kommunikations- und Informationsmittel der Zukunft zu
betrachten.
Seit der Erfindung oder Entdeckung der magnetischen
Kompaßnadel, des Kardanusrings im Sextanten und seit der seefahrenden Phönizier, den
Wikingern, der vereinigten "Ostindischen Gesellschaft" und den Teeklippern, ist
die Art und Weise der Ortsbestimmung auf See vereinfacht worden. Die Funkpeilungen, die
Funksuchsender, das "Loran"-System der Großnavigation, das
"Decca"-System der mittleren und kurzen Abstände sind verhältnismäßig alt.
Wer kennt nicht, bei seinem Besuch von Rotterdam, Ijmuiden oder Hoek van Holland, die
drehenden Antennen der Schiffe oder des Hafenradars? Sie dienen der Ortsbestimmung. Dies
sind nur einige der zahllosen elektronischen Systeme, die die Navigation stark vereinfacht
haben. Es gibt auch elektronische Echolote, die die Tiefe des Meeres an Ort und Stelle
genau anzeigen sowie die Größe der "Fischschwärme". Der Autopilot ist nicht
alleine ein Begriff der Fliegerei er hält auch Schiffe auf ihrem Kurs, unter Verarbeitung
der Daten und Seekonditionen, Wetterumstände und Beladung des Schiffes.
Bei der Offshore-Arbeit an der die niederländische
Industrie einen sehr großen Anteil hat, sind elektronische Positionsindikatoren in
Gebrauch die via Bildschirm die Pipeline auf dem Meeresgrund anzeigen. Vom Meeresgrund
können mit Hilfe von sogenannten "Sonar"-Installationen Ausdrucke gemacht
werden. Richtverbindungen der PTT sorgen für eine Kommunikation zwischen den Bohrinseln
und der Küste, direkt von Telefon zu Telefon.
Jemand der in den dreißiger Jahren diese Hilfsmittel
vorausgesagt hätte, wäre wahrscheinlich sonderbar angeschaut worden. Es konnte nach dem
damaligen Stand der Technik noch keine Leitung verlegt und durchgezogen werden. Dessen
ungeachtet sind die Geräte gekommen und die Funkoffiziere an Bord der Frachtschiffe haben
diese Geräte bedient.
Nun ist die Satellitennavigation keine Wunder mehr Nun
machen die internationalen maritimen geostationären Satelliten dem Seemann das
Kommunizieren mit der Heimat noch angenehmer. Keine Sonne mehr schießen, kein
astronomisches Besteck, aber Dank der Satelliten nahezu unmittelbar wissen wie die
Position des Schiffes ist.
Mit vielen dieser Einrichtungen hat "Scheveningen
Radio" zu tun. Mit einigen indirekt, mit manchen direkt. Bei den Gesprächen der
internationalen Beratungsorganisationen, die die Pläne der zukünftigen elektronischen
Informations- und Kommunikationsmittel ausarbeiten sowie deren Einfluß für die
Sicherheit auf See, werden Themen diskutiert, die 1985/1990 oder früher wichtig werden.
Nicht alleine regieren ist die
Voraussetzung ...
Eine Thema das demnächst aufgearbeitet werden soll, ist
das digitale "Selcal"-System, welches hoffentlich in naher Zukunft voll benutzt
werden kann. In diesem Zusammenhang steht schon die mögliche Ausbreitung dieses Systems
auf der Tagesordnung. Wie soll die elektronische Überwachung der Geräte an Bord,
hinsichtlich der Sicherheit sein? Die automatischen Zentralen der Brand- und Rauchmeldung
dienen als Vorbild.
Auf großes Interesse bei den Beratungen trifft die
Einführung der sogenannten "EPIRBS" (Emergency Position Indicating Radio
Beacom). Dieses Gerät soll automatisch oder von Hand bedient, in Notfällen Alarmierung
und Peilsignale aussenden. Es gibt Pläne zum Thema "EPIRB's", die sich mit der
Benutzung eines Kommunikationssatelliten befassen. Die Kernfragen bei den zukünftigen
Entwicklungen auf diesem Gebiet sollten folgende sein:
- Was kann der Mensch?
- Was kann die Maschine, der Automat, die
Elektronik?
- Was muß der Mensch im Mittelpunkt der
Aktivitäten selbst tun?
- Was sind die sozialen Folgen eventueller
Maßnahmen?
Dabei werden wieder andere Fragen aufgeworfen: Was sind die
starken Seiten des Menschen und was kann er besser der Maschine überlassen? Wieviel
Aufsicht muß er noch über die Maschine ausüben? Was bestimmt seine Motivation dabei?
Inwieweit ist er betroffen von dem Geschehen? Bleibt er primär im Prozeß, bei der
Beurteilung der unvorhergesehenen Situationen?
Das Letzte ist namentlich die Basis, der Ausgangspunkt. Das
Auftreten einer unvorhergesehenen Situation, das kann ein Schiffsalarm sein, z.B. ein
beginnender Brand in Raum III oder ein Defekt am Steuer. Das kann ebensogut ein Anruf an
den Funkoffizier sein, Ausschau nach einem Eisberg, Treibholz, eines Ertrinkenden oder
eines anderen Schiffes zu halten. Ein solcher Anruf kann von einem anderen Schiffe kommen
oder von einer der koordinierenden Küstenfunkstation wie "Scheveningen Radio".
Was in der Zukunft alles dann nicht von automatischen
Geräten an Land oder an Bord der Schiffe eintrifft, das soll in der Schiffskommunikation
immer eine Frage des Menschen bleiben. Sei es als Mittelpunkt der unmittelbar Betroffenen,
sei es als Bearbeiter der Signale für die Kommunikation oder als Informant.
Die Technik soll immer als Hilfsmittel und Medium gesehen
und gebraucht werden, als technische Zwischenstation im Verkehr zwischen den Menschen an
der Küste und auf See. Die schnelle und zuverlässige Hilfe für den Seemann wie
"Scheveningen Radio".
SCH 1904,
PCH 1979
oder welchen Namen dieses Bindeglied zwischen Schiff und
Festland in Zukunft kriegen wird.
|